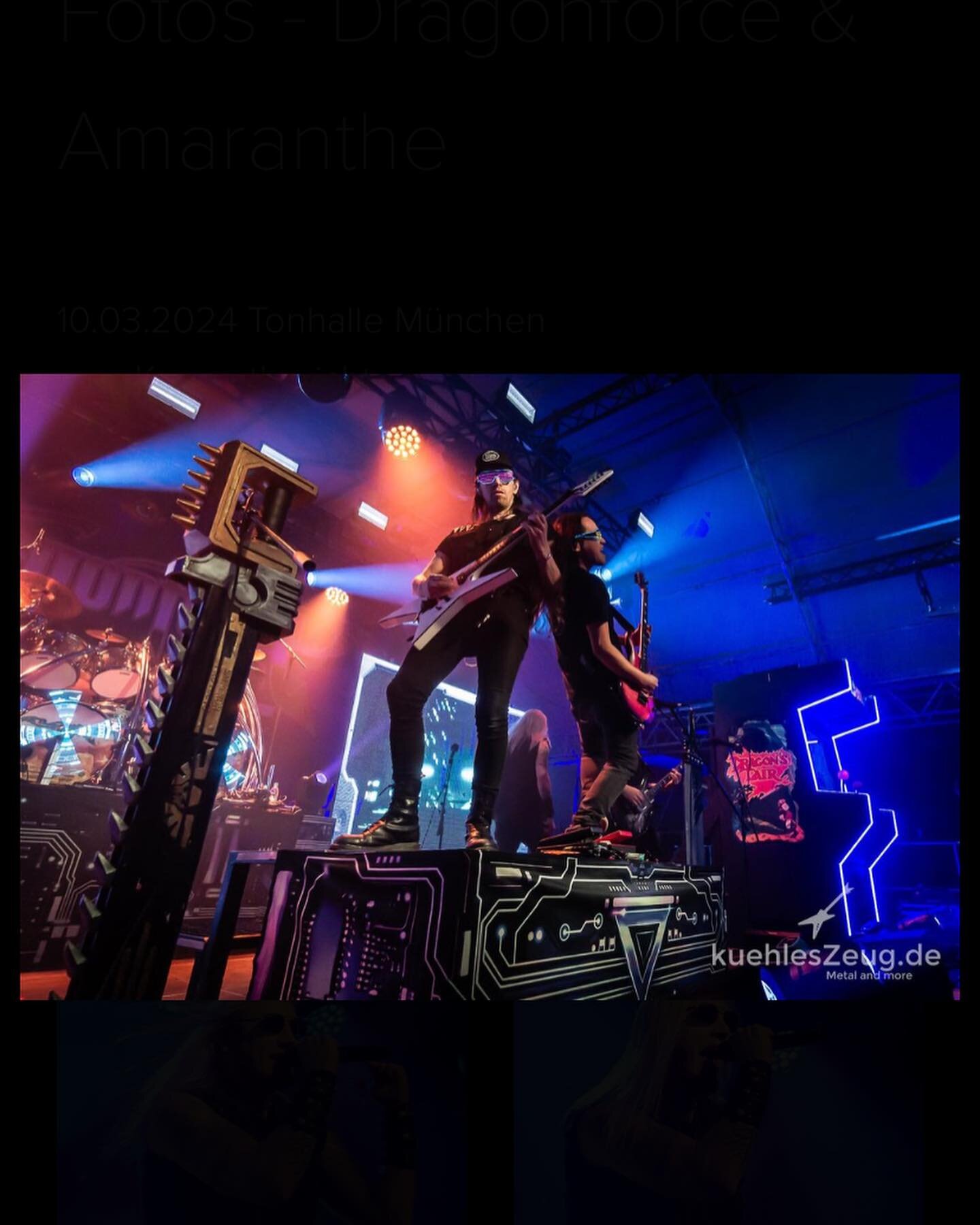Fuffsisch Jahre mach isch Metal: Judas Priest heizen uns nochmal ein – mit den Dead Daisies im Gepäck
/Zwei lange Jahre war sie verschoben, die Jubiläumsgastspielreise des britischen Metall-Schlachtrosses um Frontsirene Robert John Arthur Halford. Man mochte es kaum noch glauben, aber der Tross machte sich dann doch noch auf den Weg und legte auch in unserer schönen Stadt einen Zwischenstopp ein, was wir ausdrücklich begrüßten. Schließlich wollten wir endlich wieder gefragt werden: are you ready for some Judas Priest style heavy metal? Ah, wann’s d so fragst…
Kommt er wieder mit der Harley auf die Bühne? Und, vielleicht viel wichtiger, sitzt der Rauschebart? Eigentlich war ich ja eher zurückhaltend anfangs, die letzten Ausritte, die ich miterlebte – auf der „Nostradamus“-Tour beim Bang Your Head und bei der ersten Inkarnation des mittlerweile in die ewigen Jagdgründe eingegangenen Rockavaria – waren eher gepflegte Routine als inspirierte Darbietungen. Und man kann ja durchaus geteilter Meinung sein, ob die Formation mit den - technisch zweifelsohne versierten - Richie Faulkner (schon dabei seit 2011) und dem britischen Gitarrero und Produzentengenie Andie Sneap (eingesprungen seit 2018) an den Sportgeräten wirklich die Schuhe des neben Murray/Smith sicherlich legendärsten Gitarrenduos der Metalwelt K.K. Downing und Glenn Tipton füllen kann. Aber erstens kommt es anderster, als man zweitens denkt. Das Ganze lief ja unter dem Motto „50 Heavy Metal Years“, und ganz wie Generaldirektor Haffenloher, der Baby Schimmerlos erklärt: „swansisch Jahre mach ich Klebstoff“, will wohl auch der gute Rob wirklich nochmal „de Puppen danzen lassen“: nur so erklärt sich die Setlist, auf der sich neben den erwartbaren Schlagern der Woche à la „Breaking The Law“ auch veritable, nicht oft dargebrachte Favoriten wie das epische „The Sentinel“ und das atmosphärische „Blood Red Skies“ finden, eingerahmt von einem wirklich repräsentativen Kränzchen bunter Melodien quer durch die Bandgeschichte. Also gut, wir sind überzeugt und pilgern in das nebenbei praktischerweise direkt neben unserer Wirkungsstätte aus dem realen Leben befindliche Zenith, das seit unserem letzten Besuch 2019 bei Amon Amarth nichts von seinem rauen Industriecharme, aber auch leider etwas schwierigen Soundverhältnissen verloren hat. Sei’s drum, wir prüfen behende die Lage und stellen nach einem kurzen Abstecher zur Wasserstelle fest, dass man sich für das einzig wahre basisdemokratische Ordnungsprinzip entschieden hat: man hat das vordere Drittel abgetrennt, wer zuerst kommt steht zuerst, schnappt sich ein Bändchen und kann fortan ungezwungen hin und her diffundieren. So muss das – löblich.
Das launige Priest-Kreuz hängt schon verhüllt über der Bühne, das Backdrop kündet aber die Attraktion, die es zunächst zu studieren gilt: die Dead Daisies liefern einem mit angereisten Stilconnoisseur zufolge „powerchords“, quasi also dicke Hose Roggenroll, was bei der Besetzung auch nicht verwundern mag. Die verblichenen Gänseblümchen sind nämlich nach ihrer Gründung 2012 zu dem mutiert, was man landläufig „supergroup“ nennt: einer Ansammlung von Genre-Größen, die gemeinsam losballern. Die Gesangsdienste, die bis 2019 der wohl immer als der „andere“ Mötley Crüe-Sänger eingeschubladete John Corabi versah, übernimmt mittlerweile niemand anders als der Rock-Tausendsassa Glenn Hughes, der unter eigener Flagge, aber natürlich vor allem bei Deep Purple für Furore sorgte. Schon der Einstieg mit „Long Way To Go“ macht klar, dass mein Mitschlachtenbummler komplett richtig liegt: hier regiert das breite Riff, der klassische Hardrock und vor allem auch das virtuose Solo, für das kein anderer als der langjährige Whitesnake-Gitarrist Doug Aldrich verantwortlich zeichnet. Ob der gute Doug übrigens im gleichen Fitnessclub wie Def Leppards Phil Collen oder WASPs Doug Blair trainiert, wissen wir zwar nicht, die Ergebnisse sind allerdings ähnlich bemerkenswert. Herr Hughes freut sich natürlich, uns zu sehen – alles andere hätte uns jetzt auch gewundert – stellt fest, das habe alles viel zu lange gedauert, und mit „Unspoken“ und „Rise Up“ schiebt man weitere atmosphärische Rocker hinterher, die der Sangesmeister mit durchaus beachtlichen stimmlichen Höhenflügen begleitet. Nach „Dead And Gone“ und „Bustle and Flow“ gibt es dann mit dem epischen „Mistreated“ ein erstes Purple-Cover, dass Meister Hughes aus voller Brust schmettert und dabei seinem früheren Bandkollegen David Coverdale aus der Ferne ordentlich die Messlatte legt. „My Fate“ und „Leave Me Alone“ knallen auch ordentlich, aber so richtig aus dem Häuschen gerät die Meute beim Schlusspunkt, der auch aus der Purple-Kiste kommt: „Burn“ rauscht ordentlich rein und zeigt, wie unkaputtbar dieses Material ist. Sehr schön, vielen Dank, die Herren.
Wir schauen uns kurz um - soweit wir es von unserer Position beurteilen können, ist der Laden gut gefüllt, die ersten Sympathisanten sah ich ja morgens bei der Anreise zur Arbeitsstätte schon um die Halle tigern – ob das jetzt bis in den letzten Winkel reicht, ist weder aussagekräftig noch entscheidend. Viel spannender ist, dass die Bühne fast ein wenig ausschaut, als seien die Restbestände von Maidens Final Frontier-Tour günstig hergegangen: eine leicht futuristische Giftlagerhalle sehen wir da, „toxic waste“ überall, na so schlimm wird’s schon nicht werden, zumal die fixen Helferlein den Bühnenboden sehr gründlich schrubben. Alsbald wird das Judas Priest-Kreuz enthüllt und ergeht sich in buntem Farbenspiel, während vom Band das einschlägige „War Pigs“ der Ortskollegen von Black Sabbath ertönt. Danach geht’s aber endgültig los, die Herren Faulkner und Sneap entern die Bretter, am Schlagwerk nimmt Scott Travis die Arbeit auf, und Ian Hill am Tieftöner steht gewohnt trittsicher da. Der Chef im Ring selbst wird hereingeleitet und setzt mit dem sicherlich absichtlich gewählten Opener „One Shot At Glory“ ein: erst mal ein wenig Einsingen, das erlaubt diese Nummer vom 90er-Album „Painkiller“ allemal. Eine ziemlich imposante Lightshow wird ergänzt durch atmosphärische Videoeinspielungen, in denen sich optische Interpretationen des jeweiligen Songs mischen mit eingestreuten Covers der entsprechenden Alben. Der gute Rob wandert derzeit unentwegt von rechts nach links und wirkt manchmal, als habe er irgendwas hinter der Bühne vergessen – aber, wie schon manch einer feststellen musste, in unserer Generation gilt: unsere Erinnerung an Songtexte der 80er übersteigt bei Weitem unser Erinnerungsvermögen, warum wir eben gerade nochmal die Treppe hochgelaufen sind. Gekleidet ist er standesgemäß in einem dunklen Brillchen, der Onkel-Tom-Bart wird weiterhin gepflegt, eine wehende Lederkutte mit Priest-Emblem umschwebt die eindrucksvoll tätowierte Leibesfülle – muss ganz schön heiß sein, immerhin heizt sich die Halle zunehmend auf. Mit „Lightning Strike“ kommt die (leider) einzige Nummer vom 2018er-Kracher-Album „Firepower“ an den Start, und es zeigt sich, dass Richie Faulkner den solistischen Aufgaben mehr als gewachsen ist. Fett! Nun zieht Rob, der im Verlauf des Songs schon mal die Stufen rechts erklommen hat, die gewohnten Erkundigungen ein: „It’s Monday night and the Priest is back! Are you ready for some Judas Priest style heavy metal?”
Offensichtlich sind wir das, den das nun folgende, erste Hitparaden-Stückchen „Another Thing Coming“ wird durchaus begeistert aufgenommen, auch wenn die eine oder andere Textpassage etwas verquer daherkommt (und nur für die Komplettisten und Sprachfetischisten: jaja, eigentlich eigentlich heißt es natürlich „you’ve got another think coming“, es soll ja nicht irgendein anderes Ding kommen, sondern man soll sich da mal nicht täuschen – aber das ist halt Roggenroll, die dürfen das!). So richtig krachig ins Kontor landet dann die Speedgranate „Freewheel Burning“ vom 80er-Meisterwerk „Defenders Of The Faith“, bei der uns der gute Rob wie ein schimpfender Oberlehrer den Zeigefinger schwenkt – vielleicht, weil auch wir nicht so genau wissen, wie exakt ein Freirad denn brennend sein soll. Jetzt geht es etwas gemächlicher an, ein paar Synthesizer-Töne mischen sich hinein, auf dem Backdrop beginnen Kolben sich zu heben und zu senken – jawohl, willkommen bei den Haarspray-Priest, die 1986 mit „Turbo“ die Fangemeinde spalteten, die den Titeltrack aber mittlerweile ausnahmslos ins Herz geschlossen hat. Bei den Strophen wandert Rob wieder im Hintergrund umher, als ob er den Textzettel verloren hat, aber den Refrain ordnet er dann erfolgreich uns an – die Menge goutiert es allemal. So richtig redselig war der Gute ja noch nie, und auch heute richtet er das Wort nur für kurze Singsang-Spielchen an uns. Aber: dafür gibt’s auch keine Mätzchen wie Schlagzeug- oder Gitarrensolos (ad 1: ja, es heißt Soli, aber das ist uns egal, und ad 2: wie immer so unnötig wie Salatschleudern), sondern Schlag um Schlag die Stahlattacke, die nach „Hell Patrol“ (auch von „Painkiller“) dann in das von mir mit Spannung erwartete Endzeit-Drama „The Sentinel“ übergeht. Versehen mit flirrenden Soli, Tempiwechseln und vor allem einem mehr als nur achtbaren Gesangsvolumen ziehen wir hier endgültig den Hut: Prospekt, so wollten wir das haben. „A Touch of Evil“ bringt dann erneut die „Painkiller“-Scheibe zu Ehren, die überdurchschnittlich häufig vertreten ist – vielleicht hätte man stattdessen noch ein paar alte Klassiker eingebauen können, aber das wäre nun kleingeistig. Vielmehr freuen wir uns an einer wirklich mächtigen Fassung des Gassenhauers „Victim Of Changes“, das sie schon seinerzeit im legendären Metal-Rockpalast 1983 zum Besten gaben – lang, episch, durchaus 70er-Flair atmend, dem 76er-Album „Sad Wings Of Destiny“ geziemend. Jetzt aber wieder auf in die 80er hin zu „Ram It Down“, das zumindest bei uns rauf und runter lief und sogar eingefleischte Anhänger von Plastikmusik plötzlich zu Anhängern der IG Metall machte – und hier und heute kommt mit „Blood Red Skies“ eines der gekonntesten Stücke dieser Ära zum Vorschein, die nach meinem bescheidenen Dafürhalten genau die richtige Mischung zwischen Härte, Versiertheit und Eingängigkeit kredenzt. Lange nicht gehört, episch, gelungen, fett. Jetzt biegen wir aber doch langsam aber sicher auf die Zielgerade ein, die gepflastert ist mit alten und nicht ganz so alten Hits. Los geht’s mit dem „Green Manalishi (with the two pronged crown)”, dieser unglaublich groovigen Fassung der eigentlich eher psychedelischen Fleetwod-Mac-Nummer von 1970, deren Bedeutung sich wohl nur Autor Peter Green selbst erschließt, der als Erklärung weiland offerierte, es gehe um die Geldgier, die ihn anspringe. Wie dem auch so, das Ding rockt wie die sprichwörtliche Wutz im Wald und haut alles um – ich bin beeindruckt. Das geht dann kongenial weiter mit „Diamonds And Rust“, einem weiteren Cover, das nach der urtyptischen Priest-Behandlung zu einem Rocker avancierte, den sich Protest-Akustik-Gitarrenkönigin Joan Baez sicherlich nicht vorstellen konnte.
Jetzt richtet Scott Travis von hinter der Schießbude selbst das Wort an uns, wie es denn so sei hier, alles bestens, und ob man denn jetzt mal so richtig Gas geben wolle. Nur wenige dürften zweifeln, was nun folgt: das Brachialstakkato geht über in walzende Donnerriffs, der gute Rob keift, was der Hals nach 50 Jahren noch hergibt – der „Painkiller“ ist für viele hier immer noch die Priest-Signatur schlechthin. Das mag sein, man darf aber auch anderer Meinung sein (da haben sie deutlich besseres im Gepäck), und außerdem habe ich nie verstanden, warum man bei einem Song, der nicht anders als „Kopfwehtablette“ heißt, so schreien muss. Aber gut. Kurze Pause, ein weiterer Schlachtenbummler hatte ja ernsthafte Zweifel angebracht, ob der Herr immer noch auf dem Motorradl einfährt – und siehe da, nach einem ordentlichen „Electric Eye“ tut er genau jenes, hängt mit Lederkäppchen halb liegend auf der Harley, schnippt neckisch mit einem S&M-Schlagdingens und intoniert sehr trittsicher die Motorrad-Mär „Hell Bent For Leather“, die ja auch durchaus in anderem Kontext gesehen werde darf. Nach einem fast schon verhuschten „Breaking The Law“ wirft sich gute Mann nun eine bodenlange Lederkutte um, ein gigantischer Stier pustet sich auf, und zu den Klängen von „Living After Midnight“ muss ich nun endgültig und vollends den Hut ziehen. Die Ironie, dass die vermeintlich martialische Leder- und Nietenoptik gerade der ach so testosteronlastigen Metal-Szene der „harten Typen“ Ende der 70er eigenhändig von Halford aus einer zumindest vermeintlich ganz anderen Ecke geholt und etabliert wurde, ist ja schon wunderbar genug. Aber dass sich dieser Herr mit seinen gestandenen 72 jetzt da oben mit offener Joppe postiert, sich dabei ganz ungeniert im knappen Lederunterhöschen präsentiert und das für keinen einzigen der hier Angereisten auch nur im Geringsten seltsam ist, zeigt: Metal ist nicht martialisch oder sonst irgendwas, sondern das, was andere so gerne für sich als „inklusiv“ reklamieren würden. Sind wir hier schon lange. Sonst was? Wir sputen uns von dannen, immerhin haben die guten Herren hier deutlich jenseits der 2-Stunden-Marke brilliert, wunderbare Momente geliefert und eine schöne Reise durch die Metal-Historie abgeliefert. Und das ist ein überragender Ausgang.