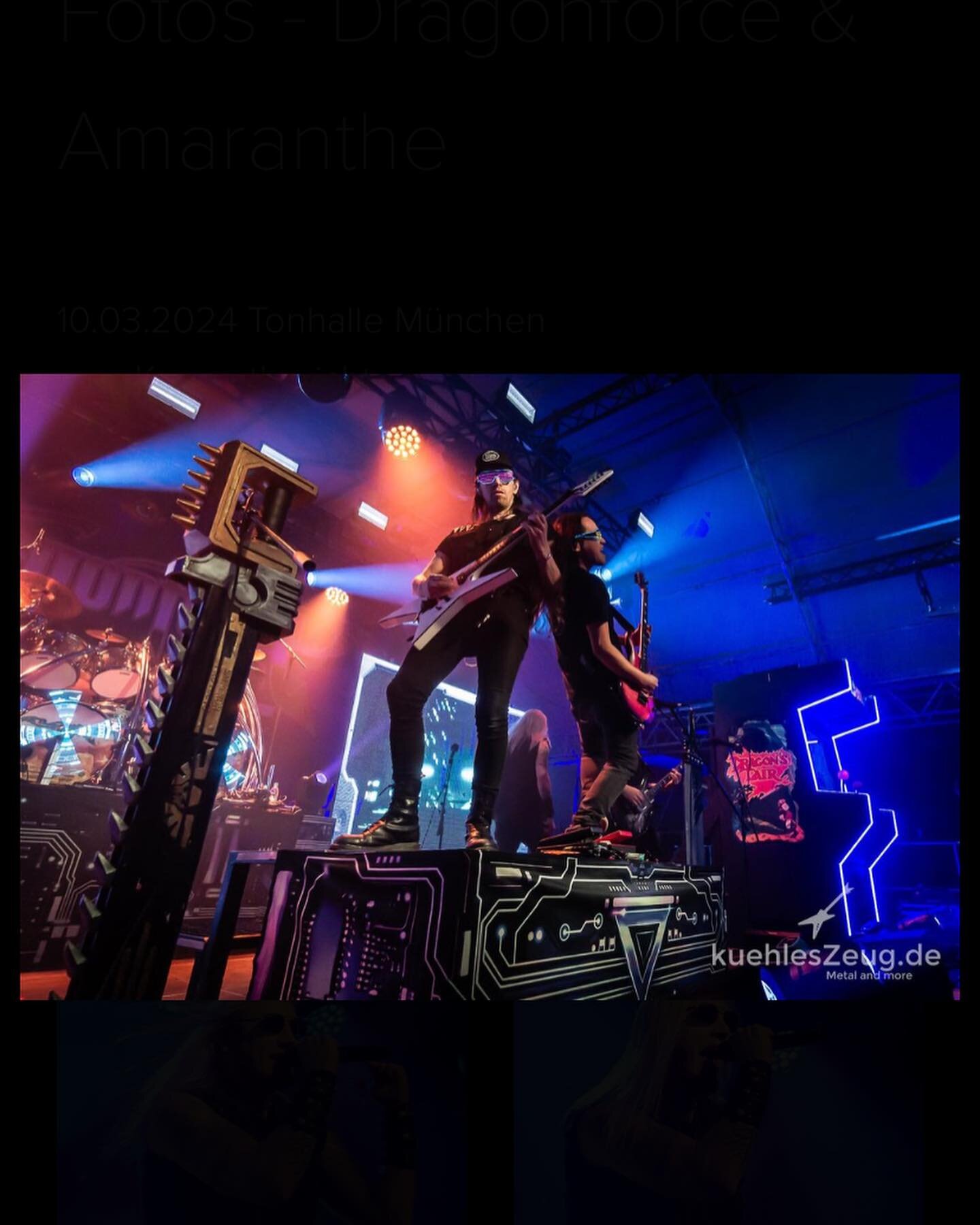Der Schrecken schleicht durch den Ruhrpott: Altmeister John Carpenter spielt seine Filmmusik für uns
/Manche Ansetzungen rechtfertigen auch durchaus längere Anreisen – insbesondere, wenn es diese sagenumwobenen Chancen sind, die sich einmal im Leben ergeben. Wenn also eine Ikone der Filmkunst sich erstmals (!) und einmalig (!!) die Ehre gibt und uns live und in Farbe besucht, nehmen wir sogar den Weg in durchaus unlauschige Gefilde auf uns und pilgern in Richtung Ruhrpott. Denn niemand anders als Altmeister John Carpenter hat sich für einen einzigen Termin in Deutschland angekündigt. Dass wir dabei nicht fehlen dürfen, bedarf hoffentlich keiner Begründung.
„Meine Freunde nennen mich Snake. Für Sie also: Mr. Plissken“. Diese doch etwas unterkühlte Begrüßung gehörte Mitte der 80er zum festen Repertoire von allen, die das damals noch neue Wunder des Videorekorders für sich entdecken durften. Da gab es einen Film mit einem Typen in Augenklappe und ärmellosem Hemd, der musste in Manhattan den dort abgestürzten Präsidenten raushauen. Das Problem: Manhattan war in dieser düsteren Zukunft als Knast komplett abgeriegelt, die Rettung war also ein Himmelfahrtskommando, aber der Haudegen „Snake“ Plissken schnarrte, schoss und prügelte sich den Weg frei. Für so ziemlich jeden aus meiner Generation dürfte das die erste Berührung mit John Carpenter – und seinem Haus- und Hof-Hauptdarsteller Kurt Russell – gewesen sein: „Die Klapperschlange“, im Original sinnigerweise „Escape from New York“, lieferte ein Paradebeispiel für das Schaffen dieses Herren. Carpenter war für die Generation Video das, was die verkopften Rollkragenpulloverträger der französischen Filmkritik gerne als „Autorenfilmer“ bezeichnen: ein Regisseur mit einer klaren Handschrift, der ganzen Genres seinen Stempel aufdrückte und einen unverwechselbaren Stil entwickelte. Mit den Streifen „Halloween“ und „The Fog“ begründete er eigenhändig den modernen Horror-Film, komplett mit damals innovativen, heute gerne parodierten Slasher-Momenten (geh niemals alleine irgendwo hin, wer Sex hat stirbt, und im Schrank ist nicht unbedingt das beste Versteck) und mystisch-bedrohlicher Atmosphäre („there’s something in the fog!“).
Mit „Das Ende“, auch genannt „Angriff bei Nacht“ (auch hier trifft das Original deutlich besser: „Assault on Precinct 13“), transportierte er den John Ford-Western in die urbane Realität: wurde bei Ford noch das Fort von Indianern belagert, sieht sich bei Carpenter eine Polizeiwache unter Beschuss, wobei sich in den umherwischenden Angreifern deutliche Anklänge an die Ästhetik von Zombie-Filmen finden. Mit seiner Version des 50er-Klassikers „Das Ding aus einer anderen Welt“ (ok, das passt der deutsche Titel) sorgte er mit expliziten, in dieser Form Anfang der 80er unerhörten Splatter-Momenten für Entsetzen - „you gotta be fucking kidding me“, kann Kurt Russell nur noch staunen, als ein Kopf Beine bekommt und losmarschiert. Auch das zutiefst schwarze Ende dieser überraschend werkgetreuen Adaption der short story „Who goes there?“ von W. H. Campbell sorgte für Grauen. Qualitätskennzeichen von Carpenters Arbeiten waren dabei stets die optimale Verwendung eines (zumindest in den früheren Filmen) begrenzten Budgets, suggestive Kameraführung, effektive Plots, ikonische Momente (Michael Meyers in der Hockeymaske dürfte zu den bekanntesten Horrorfiguren überhaupt zählen), zutiefst erschreckende, leicht kranke Atmosphäre, ein eingespieltes Team (neben Kurt Russell gehörten auch Jamie Lee Curtis und Donald Pleasance zu seiner Stamm-Mannschaft) – und die minimalistische, aber höchst wirkungsvolle Musik, die er in der Regel selbst komponierte. Diese kleinen, effektiven Synthesizer-Melodien haben sich ins kollektive Bewusstsein gebrannt, ohne dass der Mehrheit der Hörer überhaupt klar ist, dass es sich um Filmmusik handelt – in den gutbürgerlichen Radiosendern mutierten die Melodien teilweise zu Jingles und führen ein Dasein abseits ihrer Herkunft.
Wer aber wie wir Mitte der 80er in einer Video-Session erstmals „Halloween“ schaute, sich dabei unvermeidlich ein Kissen über den Kopf hielt und dabei schrie „Pass auf! Da steht er!!“, der wird diese alptraumhafte Klimpermelodie für immer mit dem Kürbiskopf der Opening Credits verbinden. Nachdem es in letzter Zeit doch ruhiger um den Altmeister wurde (in den 90ern lieferte er den zutiefst erschreckenden „In The Mouth Of Madness“, aber leider auch die Enttäuschung „Escape From LA“), notierten wir zunächst ungläubig, dann entzückt, dass er doch tatsächlich auf seiner „Retrospective“-Tournee für ein Date nach Deutschland kommt, genauer gesagt nach Oberhausen, wo er sich im Rahmen der Horror-Convention „Weekend Of Hell“ ein Stelldichein gibt. Dort können Afficionados ihren Hunger nach Filmen, Plastikfigürchen und sonstigen Memorabilia stillen – und dann am Abend in die Turbinenhalle pilgern, wo der Held einer ganzen Horrorfilmfangeneration sich die Ehre gibt. Als still und menschenscheu gilt er, der gute Mann – um so gespannter dürfen wir sein, was uns denn da erwartet. Die Anreise durch die „Chemieregion Europas“ (aha, also bei uns stehen auf diesen braunen Autobahnschildern eher Sehenswürdigkeiten, aber egal) in Richtung Essen und weiter nach Oberhausen gestaltet sich problemlos, die Turbinenhalle beheimatet neben der eigentlichen Messe auch die Konzertlokalität, die allerdings bei unserer Ankunft noch geschlossen ist – eine durchaus beachtliche Schlange hat sich da gebildet, die sich nach kurzer Wartezeit in die Räumlichkeit ergießt. Da stehen wir dann also, bestaunen den Merchandise-Stand, wo es neben den handelsüblichen T-Shirts doch tatsächlich signierte Langspielplatten (!) und dunkle Brillen gibt (später mehr dazu).
Die Halle selbst fasst wohl um die 700 Nasen, die sich brav vor der Bühne aufstellen, die bereits mit einer vollen Band-Ausstattung und vor allem einer durchaus beachtlichen Leinwand im Hintergrund geschmückt ist. Schlag 8 marschieren die dunkel gekleideten Herrschaften an ihre Geräte, und da spaziert der Meister doch tatsächlich heran: das schüttere, aber immer noch lange, mittlerweile schlohweiße Haupthaar nach hinten gebunden, Nerdbrille und Kaugummi kauend postiert er sich mittig vor seinem Keyboard, bevor er laut und deutlich zu uns spricht: „Hello, I am John Carpenter“. Ach was! Aber jetzt Licht aus, Spot an, ein pulsierender Keybard-Rhythmus ertönt, und die Leinwand erwacht zum Leben, mit einer einfachen Computergrafik, die die Umrisse von Manhattan nachzeichnen. Begeisterung allenthalben, als man tatsächlich mit „Escape From New York“ ins Set einsteigt, in einer behutsam ausgedehnten Instrumentierung, in denen der charakteristische Synthesizer natürlich immer noch dominiert. In der Folge laufen auf der Leinwand Schlüsselszenen des Films ab – in einer Art Zeitraffer erleben wir die wichtigsten Momente, während der Meister unten ein lustiges Tänzchen aufführt – vielleicht hat man ihm gesagt, dass er sich schon irgendwie bewegen muss? Die Stimmung ist in jedem Fall sofort eine Art allgemeines Glücksgefühl, das Publikum, in dem sich überraschend viele junge Leute tummeln, freut sich sichtlich über diese Kombination aus meet and greet und live-Darbietung. Weiter im Text geht es gleich mit dem zweiten Klassiker, dem „Assault on Precinct 13“, und auch hier gelingt die Verbindung der eigentlich spärlichen Melodie mit den zentralen Filmmomenten und Instrumentierung hervorragend. Irgendwie möchte man immer weiterschauen, das ist irgendwie alles viel zu schnell vorbei, und die Filme muss man sich natürlich unbedingt auch wieder ansehen – schon in der kleinen Zusammenfassung ohne Ton sind die Bilder voller Kraft und Suggestion, als die Gangs mordend die die Straßen ziehen und dann die Polizeistation belagern.
Nun spricht der gute John wieder zu uns – er habe ja nicht nur Musik für seine Filme gemacht, sondern auch eigenständige Melodien (die so genannten „Lost Tracks“) komponiert, von denen er uns heute auch einige kredenzen möchte. Mit „Vortex“ folgt nun das erste Beispiel für sein autarkes Schaffen: das kommt deutlich moderner, ausladender, länger und rockiger daher, mit fettem Gitarrenriffing und echter Songstruktur, allerdings wie alles an diesem Abend als reines Instrumental und naturgemäß ohne Filmbegleitung. Die Ansagen wirken dabei sehr akzentuiert, fast wie eine formelle Rede, die er abliest – richtig wohl scheint er sich nicht in seiner Haut zu fühlen vor so vielen Leuten, aber das respektieren wir gerne und lauschen dem nächsten Nicht-Soundtrack „Mystery“, bevor wir uns dann wieder so richtig gruseln dürfen. Kunstnebel wabert durch den Raum, auf der Leinwand schlurfen die Wasserleichen-Zombies durch einen Küstenort und krabbeln zu Adrienne Barbeau auf den Leuchtturm: was haben wir uns alle miteinander in die Hose gemacht, als der „Nebel des Grauens“ Anfang der 80er eines Samstag abends durch die heimischen Wohnzimmer kroch und uns mitsamt unseren Eltern das Fürchten lehrte. Schön schaurig kommt das auch heute. Wundervoll. Aber jetzt kommen die Requisiten zum Einsatz: Herr Carpenter setzt seine Nerd-Brille ab, zieht eine stylische Sonnenbrille auf – und grinst uns frech an, denn schließlich wissen wir alle, was uns jetzt bevorsteht. Die wunderbare Hommage an 50er-Invasionsfilme „Sie leben“ zählt für viele zu den letzten „echten“ Carpenter-Filmen. In der Kurt-Russell-Rolle erfährt Roddy Piper da bekanntlich, dass wir längst von Aliens überrannt sind, die uns als Sklaven halten: nur wer eine spezielle Sonnenbrille trägt, kann erkennen, dass Zeitungen, Werbebanner und sogar Geldscheine uns permanent suggestiv beeinflussen: „Obey!“, „Work!“, „Do Not Question Authority!“, „This Is Your God!“, steht da in Wirklichkeit zu lesen, und scheinbar harmlose Mitmenschen entpuppen sich als totenkopfbefratzte Invasoren. Auch wenn das Ende dieses wunderbar subversiven Anti-Materialismus-Amerikanismus-Epos schon damals etwas platt wirkte, schlägt die Begeisterung hier und heute hohe Wellen, zumal die Szenen sehr geschickt ausgewählt sind. „For this movie“, so erklärt er uns jetzt sehr betont, „the music was composed by Ennio Morricone. We will play it in his honour”.
Das tun sie mit einer schönen Fassung der unheilsdräuenden, langsam-kriechenden Melodie zu “Das Ding” sehr wirkungsvoll, und wir staunen einmal mehr darüber, was man Anfang der 80er Jahre vollständig ohne Computer, sondern ausschließlich mit Latex, Schminke und Kunstblut auf die Leinwand zauberte (und eben die Szenen, die bei Ausstrahlung im Fernsehen immer geschnitten sind, kommen vor – jawohl!). Nach einer weiteren, sehr brauchbaren stand alone-Komposition berichtet der Meister „I have a good friend with whom I made five movies. But never did we have more fun than when we were looking for a girl with green eyes – and found us some big trouble…” Der so angekündigte “Big Trouble in Little China” überforderte damals nicht nur uns: als eine der ersten Action-Buddy-Komödien war der Film seiner Zeit einfach voraus – nicht nur wir waren konsterniert, dass Kurt Russell hier auf einmal lustig war und John Carpenter uns irgendwie gar nicht erschrecken wollte. In der Rückschau kann man dieses Werk durchaus wiederentdecken, zumal der heute vorgetragene „Pork Chop Express“ zackig-rockig Laune macht. Nach zwei weiteren „Lost Tracks“ kündet der Meister nun in unheilsdräuenden Blick an: „I have made a lot of horror movies. I love horror movies. Because horror movies live forever…“ – genau wie ein gewisser Michael, der am Erntedankfest seine Schwester meuchelt und in weißer Maske Jahre später Jamie Lee Curtis terrorisiert. Das kleine, fiese plink plink von „Halloween“ genügt auch heute Abend vollauf, um an den Nerven zu zerren – und die Filmausschnitte zeigen, dass alle späteren Teenage Slasher Filme sich ihre Effekte bei Carpenter abgeschaut haben. Nach einem epischen, verstörenden „In The Mouth Of Madness“, in dem Sam Neill und Jürgen Prochnow sich durch ein Lovecraft-inspiriertes Alptraum-Universum jagen, ist dann erst einmal Schicht. 60 Minuten stehen da gerade einmal auf der Uhr, die Melodien dauern eben nicht lange, und das ganze ist ja auch weniger reguläres Konzert als eine Live-Werkschau in Gegenwart des Chefs. Als solche funktioniert das Ganze bestens, zumal mit „Prince Of Darkness“ jetzt eine Reminiszenz an einen seiner verstörendsten Filme folgt. Alice Cooper steht da so drohend wie eh und je, Donald Pleasance versucht den herannahenden Fürst der Finsternis abzuwehren, und das Ungeziefer krabbelt überall umher. Nun stellt er tatsächlich auch die Band vor, darunter „on lead keyboard“ sein Filius Cody Carpenter – wie viel der Darbietung nun der Herr Vater oder vielleicht doch der Sohnemann hier beigesteuert hat, bleibt ihr Geheimnis, aber um das geht es eben nicht. Als nach „Plymouth Fury“ endgültig Schluss ist und uns Carpenter noch warnt „Drive carefully – Christine is out there!”, pilgern wir frohgemut nach draußen, im Wissen, einen der ganz Großen des Science Fiction und Horror-Films leibhaftig erlebt zu haben. Solche Figuren gibt es im modernen Filmbetrieb nicht mehr – umso besser, dass sich diese Chance bot. Auch wenn wir auf die natürlich kostenpflichtigen Autogramme gerne verzichten, zumal es die erst am nächsten Tag auf der Messe zu ergattern gibt.